Workaholics, die ihre Anstellung verlieren, fallen ins Bodenlose – oder stürzen sich ohne Atempause in die nächste Aufgabe. Manchen aber gelingt der Absprung in ein Leben, das nach und nach wieder ins Lot kommt. Einfach dasitzen und nichts tun. Keine Kunst, möchte man meinen – und ein besonderes Verdienst wohl auch nicht. Doch dem widerspricht Sybille Marti* vehement. Für einen Arbeitssüchtigen sei es ein ziemlich grosser Schritt, sich klarzumachen: Du darfst auch einmal ruhen. Die 37-Jährige kann es mittlerweile – und sie fühlt sich gut dabei. Aber der Weg dahin war ein langwieriger und schmerzhafter Prozess, an dessen Anfang sie ihren Job aufgeben musste, weil sie vor Erschöpfung nicht mehr konnte. Erst das habe sie dazu bewogen, ihr Leben neu auszurichten, sich nicht mehr nur über die Arbeit zu definieren.  Auf einen Schlag ist alles weg
Auf einen Schlag ist alles weg
Wer arbeitet, ist gut – wer viel arbeitet, ist besser
Verstanden hat Sybille Marti dies alles erst im Nachhinein. Heute weiss sie: Wer süchtig ist nach Arbeit und plötzlich seinen Job verliert, kann nichts anfangen mit Ratschlägen wie «Nutze die Krise doch als Chance für einen Neuanfang oder für einen Perspektivenwechsel». Keine Arbeit zu haben, sei für jeden Menschen hart. Aber der Arbeitssüchtige verliere die Daseinsberechtigung: Auf einen Schlag ist alles weg, was Anerkennung, Bestätigung und Wertschätzung brachte – und nichts mehr ist davon übrig, was bisher das Selbstwertgefühl genährt hat. Eine bittere Erkenntnis. Und eine beschämende dazu, wenn man sich wie Sybille Marti auserwählt fühlte, als Exponentin im sozialen Bereich das Elend der ganzen Welt zu schultern und zu lindern. Jahrelang habe man ihr für Einsatz und Engagement auf die Schultern geklopft. Dann plötzlich: Bedeutungslosigkeit – ein bedauernswerter Tropf ohne Ansehen, ohne Wert, ohne Nutzen. «Viele Menschen fallen in derartigen Momenten in schwere Depressionen», weiss sie. Und die Leistungsgesellschaft macht sich einen zynischen Reim darauf: Wieder jemand, der sich aufgeopfert hat, um einer höheren Sache zu dienen. Ein Workaholic habe fatalerweise ja auch etwas Heldenhaftes, sagt der Psychiater Andreas Canziani. Diese Märtyrerrolle könne bis zum Suizid führen. Wer arbeitet, ist gut; wer viel arbeitet, ist besser. Dieser Grundsatz werde hochgehalten, sagt der Wirtschafts- und Arbeitspsychologe Stefan Poppelreuter. Daran hätten auch die Wirtschaftskrise und die Kritik an Wachstum und Gewinnmaximierung nichts geändert. Seinen Beobachtungen nach ist Arbeitssucht die einzige Suchterkrankung, zu der sich viele offen bekennen. Hart arbeiten sei schliesslich schiere Notwendigkeit, um sich und seine Familie zu ernähren: Überlebenskampf in einem Wirtschaftsumfeld, wo die Angst um den Job zu mehr Leistung antreibt. Wer schaffe und schufte, präsentiere sich als wertvolles Mitglied einer Gesellschaft, die Arbeitsethos über alles stellt, sagt Poppelreuter. Warum also sollten Arbeitssüchtige freiwillig damit aufhören, sich im Hamsterrad die Lunge aus dem Leib zu hecheln? Zumal sie im Strudel wirbelnd oft gar nicht realisieren, dass sie ein Problem haben – und somit resistent sind gegen gutgemeinte Ratschläge. Parallelen zum Burnout
Wer zugibt, dass er leidet oder nicht mehr kann, gesteht sich und anderen ein, dass er versagt hat. Deshalb, sagen Therapeuten, sei es so schwer, Arbeitssüchtige präventiv zu erreichen. Sie halten lieber durch – trotz unübersehbaren Symptomen. Zum Innehalten brauchen sie meist ein einschneidendes Erlebnis: eine Kündigung etwa oder massive gesundheitliche Probleme. Die Parallelen zum Burnout seien frappant, sagt Poppelreuter. Manchmal aber reichen selbst der Herzinfarkt oder der Kreislaufkollaps und die damit verbundene Zwangspause nicht aus, um ein gesundes Verhältnis zur Arbeit zu entwickeln. Wer arbeitssüchtig ist, sucht oft panisch die nächste Aufgabe – um dort im gleichen Muster weiter zu krampfen. Doch was treibt den Arbeitssüchtigen, als wäre er ein Junkie auf der Suche nach Stoff? Der hohe Stellenwert der Arbeit in unserer Gesellschaft sei nur eine Komponente, betont Poppelreuter. Noch stärker wiege die persönliche Disposition. Sich in eine Sucht zu flüchten, diene oft dazu, Angst zu reduzieren. Die Angst vor Demaskierung zum Beispiel: Beim nächsten Mal kommt heraus, dass ich gar nichts draufhabe; es wird offensichtlich, dass ich es nicht kann.» Solche Gedanken treiben selbst die erfolgreichsten Menschen um. Also reagieren sie darauf mit mehr von dem, was sie ohnehin schon geben – noch mehr Anstrengung, noch mehr Leistung. «Es ist, als würden sie permanent mit dem Kopf gegen die Wand rennen, statt einen Schritt zur Seite zu gehen, dorthin, wo sich die Tür befindet», sagt Poppelreuter. Manchmal sei es auch die Furcht davor, mit den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten konfrontiert zu werden. Oder die Angst vor der inneren Leere. Um sich diesen Gefühlen nicht stellen zu müssen, flüchten viele Menschen in Arbeit. Das Fatale: Es geht nicht mehr um Genugtuung und Erfüllung, wie dies bei jemandem der Fall ist, der ein gutes Mass gefunden hat zwischen Engagement und der Sorge zu sich selbst. Der Arbeitssüchtige missbraucht die Arbeit für einen anderen Zweck – als Suchtmittel. Canziani beobachtet oft, dass Arbeitssüchtige auch sonst zu exzessivem Verhalten neigen. «Wenn ich empfehle, gehen Sie doch einem Hobby nach, entscheiden sich viele für Fitness.» Weil man sich dort messen könne. Ruhe und Erholung würden dann mit Alkohol oder Tranquilizern erzwungen. Eine selbstzerstörerische Spirale. Canziani will aber nicht schwarz- malen: Aus einer derartigen Krise herauszufinden, sei möglich. Und zwar am ehesten dann, wenn man stärkt, was noch intakt ist, und vermeidet, in die nächste Mühle hinzugeraten – Opferrolle und Selbstmitleid. «Ein Arbeitssüchtiger, der seinen Job verliert, ist nicht automatisch verloren», sagt auch die Therapeutin Djurdja Petrina Bucher. Wichtig sei, seine Ressourcen zu aktivieren und zu nutzen: das soziale Umfeld; Hobbys, die Halt geben und Sinn stiften. Dazu gehöre aber auch die nüchterne Analyse, wie es zur Arbeitssucht kommen konnte – sich also zu fragen, was einem wirklich fehlt im Leben. Und man müsse lernen, konsequent zu sein, auch im Kleinen. Einen guten Job machen, keine Frage. Aber pünktlich gehen und zur Kenntnis nehmen, dass der Laden auch ohne einen läuft. Bei der Arbeit entspannen
Auch Sybille Marti hat die Konsequenzen gezogen. Sie wird ihren Lebensstandard herunterfahren und weniger Geld verdienen: der Teilausstieg aus einer arbeitsverrückten Welt. Ihr Verhältnis zur Arbeit hat sich radikal geändert – zum Guten, wie sie sagt. Neben der Erkenntnis, auch einmal nichts tun zu dürfen und trotzdem ein vollwertiger Mensch zu sein, hat sie etwas verinnerlicht, was auf den ersten Blick unlogisch erscheinen mag: Sie entspannt sich bei der Arbeit. Indem sie einen guten Rhythmus entwickelt hat zwischen Aktivität und Ruhe. Und Rücksicht nimmt, wenn Körper und Kopf nach Pausen verlangen. Und sie hat sich verabschiedet vom Glauben, es liege im Wesen der Arbeit, so viel Energie zu absorbieren, dass zum Leben keine mehr übrig bleibt.
Vera Sohmer Aus:Nzz.ch
Quítate de delante de una respuesta
Du musst sein Eingelogged um einen Kommentar zu hinterlassen.

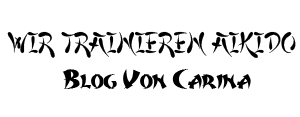





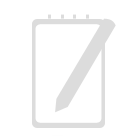

Últimos Comentarios