Ihre Eltern setzten sich schon zum Frühstück einen Schuss, mit 15 Jahren war Elizabeth Murray obdachlos und schlief nachts in der U-Bahn. Trotzdem schaffte sie den Sprung an die Nobel-Uni Harvard. US-Filmemacher und Verlage lieben die Erfolgsstory – doch Elizabeths Leben ist etwas komplizierter als im Drehbuch vorgesehen.
 eth nur mit dem Löffel essen, den ihre Eltern auch zur Drogenbereitung nutzen – und zur Schule geht sie nur selten, weil die Mitschüler sie hänseln, wenn sie verlumpt, verdreckt und stinkend auftaucht.
eth nur mit dem Löffel essen, den ihre Eltern auch zur Drogenbereitung nutzen – und zur Schule geht sie nur selten, weil die Mitschüler sie hänseln, wenn sie verlumpt, verdreckt und stinkend auftaucht.Die Behörden nehmen Elizabeth schließlich fort von den Eltern. Weil sie es nicht wie ihre Schwester bei gewalttätigen Verwandten aushält, landet sie in Erziehungsheimen und später auf der Straße. Dort erfährt sie auch vom Aids-Tod ihrer Mutter – und das macht das 16-jährige Mädchen nicht nur wütend und traurig, sondern vor allem entschlossen. „Mir waren so viele Chancen versagt worden, und ich wollte nicht auch alles Talent verschwenden“, sagt Elizabeth.
Der Fernsehfilm, an dem Murray als Beraterin mitgearbeitet hat und in dem Thora Birch aus „American Beauty“ sie spielt, ist nur stellenweise pathetisch- rührselig, aber jede Minute lang ein Vehikel für eine Botschaft: Jedes Leben ist immer das, was man daraus macht. Idealerweise ist das auch der Satz, den Elizabeth am liebsten verkündet, bei ihren zahllosen Vorträgen, für die sie durch das ganze Land reist.
Das Heldenepos – Trost für die Nation
Sie kann als Rednerin beim „Washington Speakers Büro“ gebucht werden, das auch Al Gore vermittelt oder Rudolph Guiliani, der Obdachlose am liebsten aus New York knüppeln wollte – und an manchen Tagen schüttelt Murray vor einer Ansprache erstmal die Hand von Nelson Mandela. Während des Irak-Krieges leiteten Interviewer Gespräche mit Elizabeth ein, in diesen Zeiten sei ihre Story für die Nation ein idealer Trost.
Die Sorge war unbegründet – Murray verliert kein böses Wort über die Uni. Harvard sei vielleicht nicht der ideale Ort für sie gewesen, sagt sie zwar („Mein Leben in New York war so schnell. Und hier war alles so ruhig“), aber es sei eben auch für sie nicht die beste Zeit zum Studieren gewesen. Sie habe immer so furchtbar viel zu tun gehabt, weil alle ihre Geschichte wollten – der Buchverlag, wo sie demnächst ihre Autobiographie veröffentlicht, die Fernsehsender, die Journalisten. Und dann musste sie noch bei neuen Problemen in ihrer Familie vermitteln, sich um die alten Freunde in der Bronx kümmern – irgendwann brach der Bezug zum Studium ganz ab.
Die perfekte Vermarktung
Manche Studenten aus Murrays Jahrgang klagen nun, Harvard hätte mehr Hilfe anbieten können. Allerdings gibt Elizabeth selbst zu, dass sie durch ihre frühe Eigenständigkeit nicht leicht zu beraten ist. „Es war einfach zu viel Lärm in meinem Kopf“, lautet ihr Fazit.
Lifetime braucht sie ebenfalls, etwa für Internetchats nach dem „Homeless to Harvard“-Film, der dem Sender die höchste Einschaltquote in seiner Geschichte bescherte. Der Chat ist online direkt neben einer Bannerwerbung für Gesichtswasser abrufbar, und enthält den Hinweis, dass bald Elizabeths Schwester und ihre beste Freundin ein Buch herausbringen.
The show must go on.

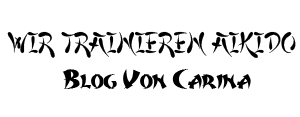





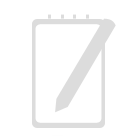

Neueste Kommentare