Größe und Kraft sind kein Garant für den Erfolg einer Art. In Zeiten knapper Ressourcen sind kleine Kreaturen anpassungsfähiger.
Wer siegt eigentlich in der Evolution? Ist es immer der Größte, Stärkste und Schönste? Oder haben die Unscheinbaren doch die Nase vorn im ständigen Werden und Vergehen der Arten?
Streng nach Darwin hängt Überleben davon ab, wer im Überlebenskampf am erfolgreichsten ist. „Aus der Ökologie wissen wir aber, dass keineswegs immer der Größere und Stärkere in der Auseinandersetzung um knappe Lebensgrundlagen der Erfolgreichere ist. Das Gegenteil trifft sogar zumeist zu“, erklärt der Münchner Zoologe und Autor zahlreicher Bücher zur Evolutionsbiologie Josef H. Reichholf gängige Thesen vom Kampf ums Überleben.
Als vor 65 Millionen Jahren der Einschlag eines Kometen fast den gesamten Globus verwüstete und in der Folge viele Ökosysteme kollabierten, wurden ausgerechnet die Dinosaurier ausgelöscht. Eine Gruppe von Tieren, die alle Lebensräume erobert hatten, Wasser, Erde und Luft, und die über 100 Millionen Jahre lang die Erde beherrscht hatten. Sie hatten sich in dieser Zeit zu baumhohen Pflanzenfressern entwickelt, wie die bis 50 Meter langen und 70 Tonnen schweren Gattungen Apato- Baro-, Brachio- oder Seismosaurus, die mit ihren giraffenartigen Hälsen die Kronen der Nadelbäume abweideten.
Jede Spezies tat das auf eigene Art und Weise, wie der besondere Bau der Zähne verrät. Berechnungen ergaben, dass die wandernden Fleischberge täglich eine Tonne Grünzeug vertilgt haben. „Die größten Pflanzenfresser nahmen während ihrer Geschichte ständig an Größe zu. Es scheint so, als habe ein einmal begonnener Prozess unaufhaltsam seinen Lauf genommen“, sagt Richard Fortey, leitender Paläontologe am Naturhistorischen Museum in London.
Formen wie die Plesiosaurier kehrten als riesige Räuber von knapp Walgröße ins Wasser zurück. Furchterregende Flugsaurier, wie die nach dem blutrünstigen aztekischen Gott Quetzalcoatlus benannte Art, beherrschten mit einer Flügelspannweite von 15 Metern die Lüfte. Doch wo sind die Giganten von einst geblieben?
Von den unzähligen Arten der Gruppe überlebten einzig die Vögel, und die sind im Vergleich zu ihren Vettern klein. Auch die bis dahin kleinwüchsigen Säuger, die lange im Schatten der Saurier lebten, kamen erfolgreich durch die Krise.
„Die Dinosaurier sind mit ziemlicher Sicherheit nicht deswegen ausgestorben, weil sie zu groß geworden sind“, sagt Reichholf. „Es gab in der faszinierenden Vielfalt dieser Tiergruppe genügend mittelgroße und kleine Arten, die der Falle des Gigantismus entgangen wären, falls es diese Falle je gegeben hat.“
Tatsächlich lebt das schwerste Tier aller Zeiten heute – noch, muss man sagen. Denn auch der Blauwal, der mit 30 Metern Länge und knapp 200 Tonnen Gewicht die Schwergewichte unter den Dinosauriern deutlich übertrifft, ist vom Aussterben bedroht. Auf die Meeressäuger macht heutzutage, obwohl international geächtet, die japanische Walflotte Jagd. Unter dem Vorwand Wale für die Forschung zu fangen, wird in Japan mit dem dort als Delikatesse geschätzten Walfleisch eine ganze Industrie beliefert. In diesem Falle begrenzt also nicht eine begrenzte Menge an Futter das Überleben der Kolosse, sondern vielmehr der menschliche Hunger auf Meerestiere.
Aber üblicherweise haben es die Riesen im Tierreich schwerer als die Leichtgewichte, weil sie ihre gewaltigen Körpermassen am Leben erhalten müssen. Sie brauchen viel Nahrung, die leicht zugänglich ist. Das bietet vor allem die Pflanzenwelt, zumindest wenn das Klima stimmt. Fleisch, das bei gleichem Gewicht mehr Energie liefert, steht immer am Ende von Nahrungsketten und muss unter hohem Aufwand an Energie erjagt werden. Ein Grund, warum Fleischfresser nie solche titanenhafte Ausmaße erreichen können.
st es Zufall, dass wiederum einem Saurier, dem von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzende 14 Meter langen und fünf Tonnen schweren Tyrannosaurus rex der Titel gebührt, das größte Raubtier zu sein, das je gelebt hat?
Manche Forscher glauben, dass Umwälzungen in der Pflanzenwelt und damit bei der Nahrungsgrundlage das Ende der Giganten eingeläutet haben. Jahrmillionen vor dem verheerenden Einschlag waren die ersten Blütenpflanzen aufgekommen, die ihre Samen in energiehaltige Gewebe verpackten. Die zunächst unscheinbaren Früchte lockten die kleinen Säuger an, die sich über die nahrhafte Kost hermachten, sie sammelten und so für die Verbreitung der Samen und damit dieser Pflanzenarten sorgten.
Eine Symbiose entstand, die ihre Spuren in den Gebissen der frühen Säuger hinterlassen hat. Diese ernährten sich, ähnlich heutigen Spitzmäusen, zunächst von Insekten, die sie mit ihren spitzen Zähnchen aufspießten. Mit dem Aufkommen der neuen Nahrungsquelle wurden die Zähne der Säuger kürzer und rückten enger zusammen. Zusammen mit den Vögeln überlebten sie die Katastrophe und entwickelten sich danach in explosiver Vielfalt weiter.
Aus energetischer Sicht sind kleine Säuger eher Verschwender. Ihr Herz schlägt schneller, sie atmen öfter und müssen deshalb verhältnismäßig mehr Nahrung aufnehmen. Deshalb sind kleine Tiere ständig damit beschäftigt Fressbares aufzuspüren. Wegen ihrer vergleichsweise kurzen Lebensdauer vermehren sie sich schneller. Ihre Strategie ist Masse statt Klasse. Damit steigen die Chancen neue Lebensräume für die Art erobern zu können und auch in einer unbeständigen Welt zu überleben.
Kleine Kreaturen sind nicht nur als Pioniere prädestiniert. Ihre Arten erweisen sich auch als besonders kreative Überlebenskünstler. Wer den Gegner nicht mit Stärke in die Flucht schlagen kann, der setzt auf subtilere Formen der Abschreckung: auf Gift zum Beispiel. Eine Strategie, auf die allerdings nur sehr wenige Säugetiere setzen, sie versteckten und verkrochen sich eher.
Nach dem Ende der Dinosaurier stiegen die Säuger zur Land dominierenden Tiergruppe auf. Eine sich schnell von der Katastrophe erholende Umwelt, die umso üppiger erstarkte, bot Nahrung in Hülle und Fülle. „Mit explosiver Geschwindigkeit entwickelten sich nun die Säuger und übernahmen die zuvor von den Dinosauriern besetzten ökologischen Nischen. Das förderte die Spezialisierung“, sagt Fortey. Zugleich legten viele ihrer Arten rasch an Größe zu. „Nur drei Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier traten neben spitzmausgroßen Tieren auch solche mit der Größe eines Hundes auf“, erläutert der Paläontologe.
Das lässt sich beispielsweise an der durch Fossilien fast lückenlos dokumentierten Evolution der Pferde ablesen. Innerhalb weniger Millionen Jahren entwickelte sich aus einem im Wald lebenden, dackelgroßen Fresser von Buschwerk, der auch zu Boden gefallene Früchte nicht verschmähte, ein ansehnlich großer Grasfresser, der die offene Landschaft bewohnte und sich zum besseren Schutz in Herden versammelte. Der Vorteil liegt auf der Hand: Große Tiere leben länger, sind gegen Fressfeinde besser gewappnet und können es sich in einer stabilen Umwelt leisten, mehr Energie in die Aufzucht ihres Nachwuchses investieren. Damit hieß es Klasse statt Masse.
Eine eher unscheinbare Gruppe von Säugetieren, die Primaten, zu denen neben den Affen auch die Menschen gehören, entwickelten eine weitaus wirksamere Waffe: ein leistungsfähiges Großhirn. In einer für die Geschichte der Evolution atemberaubend kurzen Zeit von rund einer Million Jahre legte es beim Menschen an Größe zu und ermöglicht der Art eine bis dahin unbekannte Flexibilität. Die ist heute sogar im Stande, Gesetze der Evolution außer Kraft zu setzen: Kraft seines Verstandes und der Einsicht gelingt es dem Menschen, selbst unter extremsten Bedingungen, neue Lebensräume für sich zu erobern und dort auch auf Dauer heimisch zu werden.
Aus:Welt.de

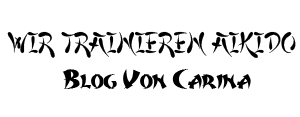





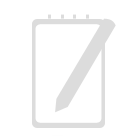

Neueste Kommentare