
Ein indischer Yogi sagt, durch Meditation seit Jahrzehnten nicht essen und trinken zu müssen. Ein wissenschaftliches Rätsel. Besser bekannt ist, was Übungen mental auslösen: weniger Stress, Angst und altersbedingter Abbau der Denkfähigkeit. Die Großhirnrinde wird sogar messbar kräftiger
Sudhir Shah ist ratlos. Der Neurologe aus einer Klinik im westindischen Ahmedabad steht vor einem Rätsel. Zwei Wochen lang hatten er und seine Kollegen den 83-jährigen Prahlad Jani untersucht und lückenlos überwacht. In dieser Zeit hat der Mann keine Nahrung und keine Getränke zu sich genommen und dennoch überlebt. Messbarer Stoffwechsel gleich null – er hat auch nichts ausgeschieden.
Jani behauptet, schon seit über 70 Jahren nichts zu sich zu nehmen und ausschließlich von der Energie zu leben, die ihm durch Yoga-Übungen, Meditation und die hinduistische Göttin Durga Amba zuteil werde. Da würde selbst Franz Kafkas Hungerkünstler neidvoll erblassen, der schrumpfte im Verlauf seiner Nahrungsabstinenz, bis er zwischen den Halmen seines Strohsitzes verschwand. Jani ist dürr, aber in guter Verfassung.
Ein wissenschaftlicher Zugang zu Janis Askese existiert bislang nicht. Etwas mehr wissen Forscher immerhin über den Zustand der Gehirne von Yogis und erfahrenen Meditierenden. Dort manifestiert sich etwas Nachweisbares. Der Psychologe Ulrich Ott vom Bender Institute of Neuroimaging an der Universität Gießen beispielsweise forscht zu Meditation, etwa zur Meditation der „Achtsamkeit“. Diese basiert darauf, alle Erscheinungen im Inneren und Äußeren gleichmütig-akzeptierend wahrzunehmen.
Der Verhaltensforscher Jon Kabat-Zinn hat die Methode der achtsamkeitsbasierten Stressminderung begründet. Sein Training „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ beinhaltet außer klassischen Meditationsübungen auch Übungen zur Steigerung der Achtsamkeit bei alltäglichen Handlungen wie Essen oder Zähneputzen. Was nach Esoterik klingt, wird nach wissenschaftlichen Kriterien erforscht. „Meditation ist angewandte Neurowissenschaft“, sagt Ott. Bei dieser Forschung geht es nicht etwa um exotische Phänomene wie ein Schweben über dem Boden oder Demonstrationen von indischen Hungerkünstlern – es geht um Menschen im Alltag und Möglichkeiten, mehr Zufriedenheit und Selbstbestimmung zu entwickeln.
Meditativ angestoßene Veränderungen beschränken sich nicht auf die subjektive Wahrnehmung. Die Übungen können auch den Blutdruck, die Herzfrequenz und den Sauerstoffverbrauch senken, wie schon in frühen Studien gezeigt wurde. Inzwischen steht indes nicht mehr diese körperliche Entspannung im Fokus der Forschung, sondern die Wirkungen von Meditation auf die Funktionen und die Struktur des Gehirns.
Die Psychologin Amishi Jha an der Universität Pennsylvania fand beispielsweise heraus, dass durch Meditationsübungen im Gehirn verschiedene Aufmerksamkeitsnetzwerke trainiert werden. Beim Ausblenden ablenkender Reize weisen die geübten Meditierenden ein besseres Potenzial auf als die Neulinge unter den Probanden. Hierbei spielt im Wesentlichen der sogenannte cinguläre Kortex im Stirnlappen des Großhirns eine Rolle. Wiederholtes Üben scheint gerade diese Region zu trainieren. Tests mit dem Kernspintomografen an der Universität Gießen bestätigen, dass erfahrene Meditierende in diesem Hirnareal eine stärkere Aktivierung zeigen als ungeübte Kontrollpersonen.
2005 erschien eine wichtige Studie: Ein Team um die Harvardforscherin Sara Lazar untersuchte 20 erfahrene Meditierende und entdeckte bei ihnen eine bis zu fünf Prozent dickere Gehirnrinde als bei Vergleichspersonen. In ihren Gehirnregionen für Aufmerksamkeit und Sinneswahrnehmungen fanden die Wissenschaftler deutlich mehr Nervenverschaltungen. Am deutlichsten waren die Ergebnisse bei den älteren Probanden. Die regelmäßige Anwendung traditioneller Meditationstechniken kann einer Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten im Alter entgegenwirken. „Wahrscheinlich wirkt regelmäßiges Meditieren einer altersbedingten Ausdünnung der Hirnrinde entgegen“, sagt Ott. Meditieren könnte ein Schutzwall gegen Demenz sein, nach dem Motto „Use it or lose it“ – gebrauche es oder verliere es.
Was geschieht genau bei dem Meditierenden im Hirn bei der Versenkung in sich selbst? Warum wirkt das Meditieren gegen Depressionen, Angststörungen, Stress und Effekte des Alterns? Wie kommt es zu den Veränderungen der Hirnstruktur, zur Vertiefung von Konzentration, Empathie, Geduld und Gesundheit? „Meditation ist ein physiologisches Herunterfahren des Körpers“, sagt Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité in Berlin. „Dabei spielt es nicht so eine große Rolle, welche Meditationstechnik man anwendet und ob man ein Mantra benutzt oder nicht. Die Meditation funktioniert wie eine Reset-Taste am Computer in Richtung Lebensstilveränderung und Gesundheit.“
Michalsen meditiert täglich von zehn Minuten bis zu einer halben Stunde. Die Regelmäßigkeit ist ihm wichtig wie das Zähneputzen. Bei jeder Tätigkeit ist unser Gehirn aktiv. Und je öfter wir sie ausüben, desto leichter absolvieren wir diese Tätigkeiten. Durch diese Wiederholungen werden die entsprechenden Strukturen im Gehirn verändert. Je mehr Zeit die Meditierenden in ihr Training verwenden, desto größer ist offensichtlich die Konzentration grauer Substanz in dieser Hirnregion.
Wer zu meditieren versucht, stößt schnell an seine Grenzen. Kleinste Sinneseindrücke lösen schon ganze Gedankenketten im Gehirn aus. Meditierende lernen, diesen Automatismus auszuschalten. „Durch Meditation kann man trainieren, gleichsam einen Schritt zwischen Reiz und Reaktion zu schalten“, sagt Ott.
Bei Depressiven kann das Gedankenfeuerwerk eine besondere Eigendynamik entfalten. Zwanghaftes Abschweifen und ständiges Grübeln über die eigene Unzulänglichkeit sind das Quälendste während einer Depression. Mit achtsamer Haltung können die Patienten diesem Horrorkreislauf entgegenwirken. Bei Depressionen wurde die Rückfallquote durch Achtsamkeitstraining um bis zu 50 Prozent reduziert.
Auch werde vermutet, dass das Immunsystem durch Meditation gestärkt und eine positive Grundeinstellung erreicht wird. Bei positiven Emotionen ist die Aktivität der linken Hirnhälfte verstärkt. „In Hirnstromkurven zeigt sich ein auffälliger Zusammenhang zwischen linksseitiger Hirnaktivität und verbesserter Immunreaktion“, erläutert Psychologe Ott.
In zahlreichen wissenschaftlichen Studien hat sich Meditation bei Schmerz, Phobien, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Rücken- und Nackenschmerzen und sogar als Prophylaxe gegen Krebs als wirksam erwiesen.
Langfristige Auswirkungen der Übung in Mitgefühl und die Fähigkeit zur Empathie wurden jüngst von einen Team um Julie Brefscynski-Lewis von der Universität Wisconsin mit funktioneller Kernspintomografie untersucht. 16 Meditierende wurden mit verschiedenen Gefühle auslösenden Geräuschen wie Weinen, Lachen, Schreien konfrontiert. Im Vergleich zu den Kontrollpersonen wiesen die Meditierenden eine stärkere Aktivierung in Regionen auf, die an der emotionalen Verarbeitung beteiligt sind und insbesondere dann, wenn es ihnen gut gelang, den beabsichtigten Gefühlszustand zu realisieren. Stärkere Reaktionen wurden von jenen Geräuschen ausgelöst, die Leiden ausdrücken und als Lautäußerungen besonders geeignet sind, bei anderen Menschen Mitgefühl auszulösen.
„Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass eine positive Grundhaltung sich selbst und den Mitmenschen gegenüber der Gesundheit förderlich ist“, sagt Ott. Wie die Kultivierung dieser Haltungen mittels Meditation unterstützt werden kann, wird allerdings erst in jüngster Zeit verstärkt untersucht. „Die unvoreingenommene Erforschung traditioneller Meditationstechniken kann den Weg zu einer neuen Bewusstseinskultur eröffnen, in der geistige Übungen und Werte ein Gegengewicht zur hektischen Betriebsamkeit der Arbeits- und Konsumwelt bilden“, sagt Thomas Metzinger, Professor für Philosophie an der Universität Mainz
von Heike Stüvel
Aus:Welt-de

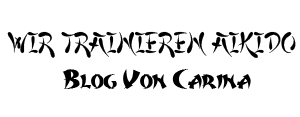





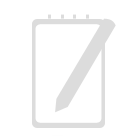

Neueste Kommentare