 Die Deutschen haben in nur zehn Jahren pro Tag eine Stunde Schlaf verloren. Doch Qualität zählt mehr als Quantität
Die Deutschen haben in nur zehn Jahren pro Tag eine Stunde Schlaf verloren. Doch Qualität zählt mehr als Quantität
Von Fanny Jiménez
Guter Schlaf ist ein Segen. Er sorgt dafür, dass wir tagsüber fit sind, reguliert den Stoffwechsel und festigt das Immunsystem. Unter seiner Aufsicht werden Erinnerungen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen und emotionale Erfahrungen geordnet und verarbeitet.
Eine ganze Stunde dieses kostbaren Guts haben wir in den vergangenen 20 Jahren eingebüßt. Der Schlafforscher Thomas Pollmächer vom Zentrum für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt ist sich sicher: Dass Menschen in modernen Gesellschaften weniger schlafen, liegt an den veränderten Lebens- und Arbeitswelten. „Moderne Industriegesellschaften machen die Nacht zum Tag, die Erde zu einem Dorf und erwarten vom Einzelnen ein Zeitmanagement, das dem Diktat der Leistungsoptimierung unterliegt.“
Auch Ulrich Voderholzer von der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg ist sich sicher: „Menschen in einer Rund-um-die-Uhr Gesellschaft mit immer mehr voll gepackten Tagesabläufen sollten auf ausreichenden und regelmäßigen Schlaf achten.“ Wer wenig schläft, leidet also? Ganz so einfach ist es nicht. „Es besteht keineswegs ein linearer Zusammenhang zwischen Schlafdauer und Gesundheit“, erklärt der Schlafforscher.
Das liegt daran, dass die Schlafdauer von vielen Faktoren beeinflusst wird. So schlafen Frauen etwa eine Stunde länger als Männer. Das Alter entscheidet ebenfalls darüber, wie viel Zeit man im Bett verbringt. Während Babys noch etwa 16 Stunden pro Tag schlummern, sind es beim Erwachsenen rund siebeneinhalb. Ältere schließlich schlafen bis zu einer Stunde weniger, nicht mehr so tief und liegen länger und häufiger wach.
Wie lange man vor dem Zubettgehen wach war, spielt eine bedeutende Rolle für die Schlafdauer. Auch die Genetik und gesundheitliche Faktoren steuern ihren Teil bei. So schläft man häufig mehr, wenn man krank ist und das Immunsystem auf Hochtouren läuft. Bestimmte chronische Krankheiten aber kosten Schlaf – zum Beispiel Autoimmunkrankheiten.
Anzeige
Genauso wichtig wie die Schlafdauer sind jedoch der Zeitpunkt des Schlafes und seine Verteilung über Tag und Nacht. Wann wir müde werden, bestimmt dabei der sogenannte zirkadiane Rhythmus. Das ist der innere Zeitgeber, der alle biologischen Funktionen steuert und synchronisiert. Dieser Rhythmus hat beim Menschen etwa eine Tageslänge und passt sich Tag für Tag dem Wechsel von Licht und Dunkelheit an. „Das evolutionäre Ergebnis ist, dass man nicht passiv auf diese Veränderungen reagiert, sondern dass sich der Körper darauf einstellt“, sagt Dieter Kunz, Leiter der Arbeitsgruppe Schlafforschung und Klinische Chronobiologie an der Charité Berlin. Der Wach-Schlaf-Rhythmus stimmt daher in der Regel mit dem Wechsel von Tag und Nacht überein.
Seit der Entwicklung der Glühbirne sind wir jedoch zunehmend unabhängig von natürlichem Licht. Der Schlafforscher Wilse B. Webb von der Universität Florida in Gainesville nennt dies den „Edison-Effekt“. Wenn Licht und Dunkelheit von Neonröhren, Schreibtischlampen und Laptop-Flimmern statt vom natürlichen Licht gesteuert werden, muss unser Körper Höchstarbeit leisten, um seinen eigenen Rhythmus kontinuierlich anzupassen. „An einem grauen Wintertag haben wir draußen 1000 Lux“, sagt Kunz. „Dafür sind wir gebaut. Und nicht für die 50 Lux bei künstlichem Licht.“
Meist kann man sich nicht aussuchen, welches Licht einen tagsüber begleitet. Dennoch kann man den Experten zufolge mit einer guten Selbstbeobachtung der eigenen inneren Uhr gerecht werden. Auch Schichtarbeit und Reisen in andere Zeitzonen müssen dabei nicht zum Problem werden.
Denn der Schlaf in einem Stück über Nacht ist nicht immer notwendig und für jeden passend. „Ein Mittagsschläfchen wirkt oft Wunder“, sagt Thomas Pollmächer. Wichtig sei die Schlafqualität, also erholsamer Schlaf, der einen ausgeruhten Start in den nächsten Tag ermögliche. „Schlafen ist flexibel, wenn auch in bestimmten Grenzen“, erklärt er.
Ähnlich sieht das auch der Psychologe Dieter Riemann vom Universitätsklinikum in Freiburg. „Beim Schlaf funktioniert vieles“, sagt er. „Das hängt auch von der persönlichen Vorliebe ab und davon, ob die Umgebung es zulässt.“
Was jedoch, wenn trotz aller Bemühungen der Schlaf zu kurz kommt? Neben der Schwierigkeit, den Körper auf künstliche Tag- und Nachtphasen einzustellen, führt Stress in Beziehungen oder am Arbeitsplatz gelegentlich dazu, dass die Schlafqualität leidet.
„Solche temporären Schlafprobleme werden leider oft zu chronischen Schlafstörungen“, sagt Riemann. Oft sei der Auslöser ein emotional aufwühlendes Ereignis wie ein Trauerfall oder die Geburt eines Kindes. Wenn in der Folge die Sorge um die verlorene Schlafzeit das Denken immer stärker bestimmt, führt das häufig in einen Teufelskreis. „Man kommt damit zurecht, man schläft schlecht, nimmt ein Schlafmittel, schläft noch immer schlecht, geht zum Arzt und leidet immer mehr.“
Hilfe ist notwendig, wenn der Schlaf längere Zeit nicht erholsam ist und Erschöpfung den Alltag bestimmt. Denn die möglichen Folgen sind gravierend. Erhöhte Infektanfälligkeit, Übergewicht, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Alzheimer und fast alle psychischen Erkrankungen hängen eng mit Schlafstörungen zusammen.
Aus:Welt.de

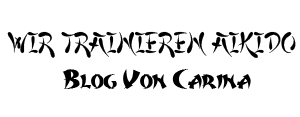





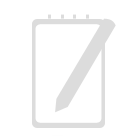

Neueste Kommentare