Wir alle haben unsere Routinen, schon am Frühstückstisch: Das Butterbrot liegt immer links, das Milchglas steht rechts. Unbewusste Handlungs- und Gefühlsmuster erleichtern das Leben enorm.
Der kleine Paul muss immer auf der linken Seite einschlafen. Seine ältere Schwester Julia sortiert alle ihre Bücher alphabetisch. Mutter Anna kann ohne Kaffee morgens nicht aufwachen. Und Vater Markus legt seine Hausschlüssel immer auf das Fensterbrett, statt sie an das Schlüsselbrett im Haus der Familie zu hängen.
Routine entsteht, wenn eine Handlung, ein Gefühl oder ein Gedanke sich oft wiederholt und damit zur Gewohnheit wird – also zur Handlung, die ohne bewusstes Steuern automatisch abläuft.
Psychologen unterscheiden Denkgewohnheiten, Gefühlgewohnheiten und Verhaltensgewohnheiten. Wie man sein Frühstücksbrot bestreicht, das Auto einparkt, durch die Regalreihen im Supermarkt geht und ob man seine Zigarette mit oder ohne Filter raucht, all das zählt zu den Verhaltensgewohnheiten. Auch Rituale gehören dazu, wie etwa der Espresso nach dem Mittagessen oder die 20-Uhr-Nachrichten im Fernsehen.
Ärger nach ein paar Minuten
Gefühlsgewohnheiten hängen sehr vom Temperament und der Persönlichkeit ab. Sie beschreiben die Tendenz, in einer bestimmten Situation häufig mit dem gleichen Gefühl zu reagieren – etwa wenn jemand automatisch sehr verärgert ist, sobald er ein paar Minuten auf andere warten muss.
Die Denkgewohnheiten dagegen spiegeln Einstellungen und Werte wider: ab wann jemand für unzuverlässig, klug oder bescheiden erklärt wird, oder was moralisch richtig und falsch ist. Diese Denkroutine beinhaltet auch, welches Bild man von sich selbst hat und wie die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse eingeschätzt werden. Viele dieser Gewohnheiten haben sich mit der Zeit so leise und schleichend entwickelt, dass sie nur dann auffallen, wenn sie gestört werden.
Handlungen automatisieren
Das menschliche Gehirn liebt Gewohnheiten. Es versucht nicht nur, neue Handlungen möglichst rasch zu automatisieren, sondern schüttet auch körpereigene Belohnungsstoffe aus, wenn es routiniert handeln darf, sagt der Bremer Neurobiologe Gerhard Roth vom Institut für Hirnforschung. „Das Gehirn belohnt Routinehandlungen, weil sie sehr viel weniger Stoffwechselenergie und sonstigen neuronalen Aufwand benötigen“, sagt er.
Gewohnte Handlungen laufen sicher, präzise und schnell ab – ganz im Gegensatz zu neuen und ungewohnten Aufgaben. Dann muss das Arbeitsgedächtnis in der Großhirnrinde eingeschaltet werden, was viel mehr Zeit und Energie erfordert. „Die Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses sind begrenzt und störanfällig, daher gehen komplizierte Dinge, die wir lernen müssen, anfangs nur holprig vonstatten, und wir müssen uns darauf konzentrieren“, sagt Roth.
Zwischenschritte vergessen
Wer etwa Autofahren lernt, bei dem werden neue Netzwerke für das ungewohnte Verhalten angelegt. Die Großhirnrinde arbeitet dafür mit Zentren zusammen, die für unbewusste, automatisierte Handlungen oder Reflexe zuständig sind, etwa das Kleinhirn oder die sogenannten Basalganglien. Sie steuern über 90 Prozent unserer Alltagshandlungen.
Mit mehr Übung würden diese Netzwerke immer effektiver, sagt Gerhard Roth, und umso weniger müsse man sich konzentrieren. Zum Schluss bleibe nur noch ein „begleitendes Bewusstsein“. Je automatisierter die Handlung wird, desto mehr verlagert sich die Aktivität schließlich aus der Großhirnrinde in Kleinhirn und die Basalganglien.
Während etwa beim Autofahren alle Schritte anfangs nur mit großer Anstrengung gelingen, wissen viele nach einigen Monaten Erfahrung zwar noch, wie Autofahren geht, die vielen kleinen Zwischenschritte aber haben sie vergessen.
Gehirn spart sich Arbeit
Außer dem Gehirn Arbeit zu sparen, hat Routine aber noch andere Vorteile. Viele Verhaltensgewohnheiten drehen sich um Aufwachen und Schlafengehen sowie ums Essen. Körperliche Grundbedürfnisse wie Hunger und Müdigkeit kommen immer wieder – und führen deshalb zu einer Regelmäßigkeit im Alltag.
Ein strukturierter Tag mit immer gleichen oder zumindest ähnlichen Abläufen gibt Sicherheit und spart Zeit und Energie für neue Informationen und Anforderungen, die bewältigt werden müssen.
Wie sehr Menschen eine solche Tagesroutine brauchen, ist unterschiedlich. Psychologen haben herausgefunden, dass etwa 20 Prozent aller Menschen „sensation seeker“ sind, also das ständige Bedürfnis nach Abwechslung und neuen Erlebnissen haben. Die große Mehrheit aber braucht Routine im Alltag, um sich wohlzufühlen.
Gefühl für Zeit und soziale Regeln
Warum, das wird besonders bei Kindern deutlich. Täglich wiederkehrende Abläufe zu denselben Zeiten geben kleinen Kindern Sicherheit und Orientierung und stärken ihr Gefühl, zu einer Gruppe dazuzugehören, sagt die Heilpädagogin Susanne Pohl.
Außerdem vermitteln feste Alltagsstrukturen ein erstes Gefühl für Zeit und soziale Regeln. Schon für Säuglinge sei Routine wichtig, etwa beim Füttern. „Diese Zuverlässigkeit wirkt sich unmittelbar auf die Bindung zwischen Mutter oder Vater und Kind aus“, so Pohl. „Das Baby erfährt Sicherheit und Zuwendung über die Versorgung und Befriedigung seines überlebenswichtigen Hauptbedürfnisses: den Hunger zu stillen.“
Susanne Pohl ist am Oberlinhaus in Potsdam auf die Frühförderung von Vorschulkindern spezialisiert. Oft trifft sie dabei auch auf Kinder, denen Routine im Alltag fehlt. Für diese sei es schwer, sich auf eine Situation ganz einzulassen, da sie jederzeit mit einer Veränderung rechnen müssen.
Feste Essenszeiten
„Für ein Kind gibt es nichts Schlimmeres als das Unvorhersehbare, denn das macht Angst“, sagt sie. In einer Familie ohne feste Essenszeiten etwa, die sie betreute, aß das jüngste Kind immer und überall mit – denn es wusste nicht, wann es das nächste Mal etwas angeboten bekommen würde. Bereits im Alter von fünf Jahren war es stark übergewichtig.
Oft haben solche Kinder auch Probleme, sich an Regeln zu halten. „Und häufig erlebt man auch Bindungsauffälligkeiten“, sagt die Heilpädagogin, „denn die Kinder haben ihre Bezugspersonen nicht als zuverlässig in der Versorgung ihrer Bedürfnisse erlebt.“
Eine Tagesroutine mit festen Gewohnheiten zu entwickeln lässt sich zwar in jedem Alter lernen, Studien der Hirnforschung zeigen aber, dass die ersten zehn Lebensjahre dafür besonders geeignet sind. Doch auch später lassen sich alte, ungeliebte Gewohnheiten noch durch neue Handlungsmuster ersetzen – allerdings brauchen wir dazu dann viel Zeit und Geduld.
Alte Gewohnheiten
„Eine alte Gewohnheit durch eine neue zu ersetzen ist das Schwerste, was es für das Gehirn gibt“, sagt Neurobiologe Gerhard Roth, „denn die Gewohnheits-Netzwerke, die sich nun in den Basalganglien und im Kleinhirn befinden, sind nicht mehr direkt unserem bewussten Willen ausgesetzt. Dadurch machen sich die Routinen und Gewohnheiten ziemlich immun gegen Veränderungen.“
Schon bei Fischen lässt sich zeigen, wie groß die Macht der Gewohnheit ist. Schiebt man eine Glasscheibe ins Aquarium, um die sie einen Bogen machen müssen, behalten sie die neue Schwimmroutine auch bei, wenn die Glasscheibe wieder entfernt wird.
Auch wenn es schwerfällt – mit viel Aufmerksamkeit und Übung können neue Abläufe ebenfalls zur Gewohnheit werden. Bei komplexen Veränderungen wie einer neuen Sportroutine braucht es gut zwei Monate täglichen Übens, wie Studien zeigen.
Mit dem Großhirn, das beim Menschen dafür geschaffen ist, Neues schnell zu lernen, haben wir zumindest den Fischen gegenüber doch weitaus bessere Karten.
Aus Die Welt

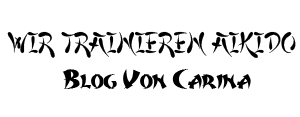






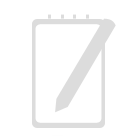

Neueste Kommentare