 Mit elf schrieb er Programme für Investmentbanken, mit 19 gründete er seine erste Firma, mit 27 war er in Amerika Unternehmer des Jahres, mit 33 verkaufte er seine IT-Firma an Microsoft. Jetzt hilft der US-Millionär William Hiroyuki Saito japanischen Erfindern. Martin Köllingsprach mit ihm
Mit elf schrieb er Programme für Investmentbanken, mit 19 gründete er seine erste Firma, mit 27 war er in Amerika Unternehmer des Jahres, mit 33 verkaufte er seine IT-Firma an Microsoft. Jetzt hilft der US-Millionär William Hiroyuki Saito japanischen Erfindern. Martin Köllingsprach mit ihm
DIE WELT: Wie fühlt man sich als Mitverantwortlicher für die Weltwirtschaftskrise?
William Hiroyuki Saito: Wie meinen Sie das?
DIE WELT: Sie sollen für die damalige Investmentbank Merrill Lynch Programme zur Kalkulation im Derivatehandel entwickelt haben.
Saito: Stimmt, eine Jugendsünde. Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich damals erst elf Jahre alt war. Wir wohnten in Kalifornien, und am Wochenende hat mich mein Vater zu Merrill Lynch gefahren. Er saß in einem Café, während ich in der Bank bei den Programmierern war. Während der Woche habe ich dann die Programme geschrieben, die wir am Wochenende darauf ins System fütterten. Ich konnte ja nicht wissen, was sich daraus entwickelt.
DIE WELT: Ziemlich freakig.
Saito: Nein, nein, ich war ein ganz normales Kind. Nur habe ich in meiner Freizeit nicht wie meine Klassenkameraden Ford Mustangs auseinandergeschraubt, sondern erst Radios und Fernseher, später Computer. Damals war ich damit vielleicht ziemlich einzigartig. Aber heute kenne ich eine Reihe Elfjähriger, die besser sind, als ich es damals war.
DIE WELT: Wie sind Sie darauf gekommen?
Saito: Dafür sind wohl meine Eltern verantwortlich. Sie sind 1969 von Japan nach Los Angeles ausgewandert, 1971 kam ich dann zur Welt. Sie meinten dann später, Mathematik wäre wichtig für mich – ohne zu ahnen, was sie sich damit antaten. Am Ende der Grundschule musste ich nicht mehr zum Mathe-Unterricht, weil ich mich schon mit College-Mathe beschäftigte. In der Zeit, in der die anderen im Unterricht waren, saß ich am Schulcomputer. Meine Eltern nahmen dann eine zweite Hypothek auf das Haus auf, um mir einen Rechner zu kaufen. Den habe ich dann wie die Radios auseinandergenommen. Meine Eltern waren kurz davor, mich umzubringen. Mein Leben hing sozusagen davon ab, das Ding wieder zusammenzusetzen. Das habe ich geschafft. Danach wusste ich, wie ein Computer funktioniert.
DIE WELT: Nach „9/11“ in New York waren Sie Sicherheitsberater der US-Regierung?
Saito: Ja, ich bin damals am richtigen Ort in die richtige Zeit geboren worden. Damals herrschte eine Aufbruchstimmung, eine verrückte Zeit. Mit meinem Klassenkameraden Tas Dienes habe ich damals I/O-Software gegründet. Unser Hauptquartier war mein Wohnheimzimmer an der Universität von Kalifornien, wo ich Biomedizin studierte. Plötzlich klingelte einer unser Klienten an, der japanische Großkonzern NEC. Die wollten uns treffen. Das hat uns in ziemliche Panik versetzt, denn als Japaner wusste ich, wie konservativ japanische Manager sind. Es war schon schlimm genug, dass wir sehr jung waren. Aber hätten wir sie in unserem damaligen Hauptquartier zwischen Bettlaken und Schreibtisch empfangen, wäre es aus gewesen. Wir haben also in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in einem Industriegebiet Räume angemietet, Computer reingestellt und Freunde gebeten, so zu tun, als ob sie dort arbeiten würden. Die Täuschung gelang.
DIE WELT: Was haben Sie damals erfunden?
Saito: Ach, alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel ein Programm für IBM-Rechner mit amerikanischem Betriebssystem entwickelt, die dann plötzlich japanische Schriftzeichen drucken konnten. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, aber damals gab’s das schlicht nicht. Aber unsere Spezialität wurde Sicherheitssoftware, biometrische Erkennung von Fingerabdrücken und das Scannen der Augeniris. 1995 entwickelten wir dann die Treiber für das erste von Toshiba entwickelte und auf Windows basierende Videokonferenzsystem. Sony hat das später auch übernommen. Für Sony haben wir dann ein Fingerabdruckerkennungssystem für PCs entwickelt, mit dem wir dann einige Industriepreise einheimsten. Aber richtig in die Umlaufbahn katapultiert hat uns der Entschluss, daraus eine offene Plattform zu entwickeln. Die wurde später zum Industriestandard. Das biometrische Applikationsprogramm Interface Bapi hat Microsoft 2000 für sein Programm SecureSuite genommen. Vier Jahre später kauften sie unsere Firma, und seitdem sind wir gemachte Leute.
DIE WELT: Und was macht man als gemachter Mann?
Saito: Zuerst habe ich die USA in Sicherheitsfragen beraten. Ich war auch Chief Technology Officer in verschiedenen Firmen. Seit ein paar Jahren lebe ich in Japan, weil ich aus Dankbarkeit etwas zurückzahlen möchte. Denn ich habe mein Niveau nur durch Förderer erreicht, die mir Fehler verziehen haben. So habe ich in Japan die Firma InTecur gegründet und helfe Unternehmen, Erfolg versprechende Ideen zu erkennen und zur Marktreife zu bringen. Außerdem arbeite ich als Start-up-Berater am nationalen Institute for Advanced Science and Technology.
DIE WELT: Vom quirligen Silicon Valley ins Start-up-feindliche Japan? Wer in Japan ein einziges Mal scheitert, kriegt doch nie wieder eine Chance.
Saito: Viele meiner Freunde sitzen jetzt in China. Die fragen mich immer, was ich denn in Japan mache, Japan sei auf dem absteigenden Ast. Das stimmt in einem Punkt: In Japan würde sich heute sicher kein neues Sony entwickeln. Sony ist zu Anfang gescheitert, erst im zweiten Anlauf brachten sie mit dem Transistorradio einen Hit zustande. Wer heute in Japan strauchelt, ist gesellschaftlich tot und kann nur noch auswandern. Dennoch halte ich Japan noch immer für eines der innovativsten Länder der Welt. Es ist eine Kraft, die viel tiefer reicht als in China. Die sind noch nicht in der Weltspitze angekommen. Es wird noch einige Zeit brauchen, bis sie technisch in dieser Breite so weit oben angekommen sind. Denn eine Innovationskultur ist weit schwerer zu erzeugen als ein Start-up-freundliches Klima.
DIE WELT: Das hört sich wie Pfeifen im Walde an. Woher der Optimismus?
Saito: Nehmen Sie Südkorea. Da vibriert alles, obwohl dort lange Zeit wie in Japan ein Job in der Bürokratie oder bei einem Großkonzern als das Größte galt. Aber in der Asienkrise 1997 mussten dann selbst Riesen wie Samsung ihre besten Leute feuern. Seitdem ist es nicht mehr peinlich, für kleine Unternehmen zu arbeiten. Jetzt ist auch Japan endlich so weit. Bei einer Staatsverschuldung von über 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts begreifen die Menschen langsam, dass der Staat sie nicht mehr retten wird. Ich hoffe deshalb, hier den nächsten Technologie-Star zu finden.
DIE WELT: Untersuchungen zeigen, dass 25- bis 35-jährige Männer sich nicht einmal mehr für Fernseher und Autos interessieren, sondern nur noch für Handys und Gesichtscreme.
Saito: Ja, japanische Mütter platzen immer noch vor Stolz, wenn ihr Sohn Bürokrat geworden ist. Eine Stanford-Mom würde sich dafür zu Tode schämen. Aber die Regierung ist fest entschlossen, in Japan eine Erfindung vom Format von Google zu wiederholen. Das Problem dabei ist das der letzten Meter. Für so einen großen Wurf reicht Geld nicht aus. Den Jungunternehmern, Gründern und Erfindern fehlt Managementerfahrung. Der Staat, die Banken, die Handelshäuser haben keine Erfahrung mit Start-ups. Die haben keine Ahnung, wie man ein Klo sauber kriegt. Lachen Sie nicht! Kloputzen ist ein wichtiger Teil beim Wachstum eines Gründungsunternehmens. Wer nicht die Niederungen kennt, wer zu schnell Erfolg hat, kriegt Angst, verliert seine Wendigkeit und erstarrt. Ich habe das häufig erlebt. Ich kann da helfen. Obwohl das ziemlich harsch ausfallen kann.
DIE WELT: Schwimm oder stirb – klingt sehr amerikanisch, ist aber völlig unjapanisch. Fujitsu oder Panasonic schicken ihre Ingenieure in Venture-Tochterfirmen mit Rückkehrgarantie und demselben Gehalt. Allerdings ohne Konzernbürokratie.
Saito: Ein zweischneidiges Schwert. Es geht doch um Ideen, um Kreativität, um eine Unabhängigkeit, die dazu zwingt, erfolgreich zu sein. Der typisch japanische Mittelweg bringt es deshalb nur auf mittelmäßige Resultate. Die Japaner müssen verstehen lernen, dass ein Unternehmer jemand ist, der das Risiko entschärft. Aber in Japan kann kaum einer mehr Risiken einschätzen, weil Japaner von der Geburt bis zum Tod betütert werden.
DIE WELT: Dafür stehen die japanische Auto- und Elektronikindustrie aber ziemlich gut da.
Saito: Alles Ausnahmen. Japanische Unternehmen tun sich schwer damit, internationale Standards durchzusetzen. Dazu braucht man Forscher, die sehr gut Englisch können, stark im Argumentieren und Stimmensammeln sind, die Know-how besitzen. Das gibt es in Japan kaum.
DIE WELT: Wie könnte es denn laufen?
Saito: Ich habe einmal mit einer Firma einen digitalen Bilderrahmen entwickelt. Das Produkt ist ein Reinfall gewesen. Aber dann haben wir den Mobilnetzbetreiber Softbank überredet, einen UMTS-Handychip einzubauen. Jetzt kann man per Handy einfach Bilder auf den Bilderrahmen senden.
DIE WELT: Ist das nicht das Unternehmen, das der Selfmademan Masayoshi Son führt?
Saito: Richtig, Son ist einer der wenigen aus der IT-Bubble-Zeit, der es zu was gebracht hat. Er wollte ein neues Produkt haben, das den Datenverkehr erhöht, aber keine zusätzliche Last fürs Netzwerk mit sich bringt. Also haben wir auch eine Methode entwickelt, mit der die Bilder erst nachts übertragen werden, wenn das Netz kaum genutzt wird. Das Produkt hat sich als Hit unter Großeltern herausgestellt, die damit immer neue Bilder von ihren Enkeln bekommen.
Aus: Die Welt.de

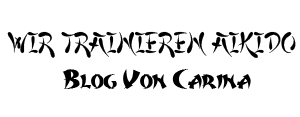





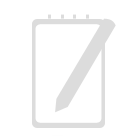

Neueste Kommentare