Wäre die Welt eine Schulklasse, man könnte Japan für den Oberstreber halten, der jeden Tag freiwillig nachsitzt, während Deutschland versucht, sich mit gefälschten Entschuldigungen am Unterricht vorbeizumogeln. Vielleicht liegt hier das Missverständnis zwischen beiden Ländern: Seiner Empfangsdame gehe es nicht um eine Schau für ihren Chef, glaubt Coulmas. Es gehe um das Selbstbewusstsein, als Empfangsdame einen großartigen Job zu machen. Vielleicht ist es diese Befriedigung, mit der in Japan auch Taxifahrer, Kellner und Putzfrauen über ihre Arbeit sprechen, die Deutsche befremdet, weil sie verdächtig nach arbeitgeberfreundlichem Masochismus klingt. Es ist ein Winterabend in einem Straßenlokal in Shinjuku, einem Bürostadtteil von Tokyo. Anzugträger sitzen hier im Halbdunkel, ein Absackerglas warmen Sake vor sich. Yuka Kishimoto hat die Waseda-Universität besucht, eine der angesehensten Schulen des Landes, jetzt arbeitet sie als Assistentin in einer Personalberatung im Stadtteil Hamamatsucho. Es ist 22 Uhr, Kishimoto hat Feierabend, seit neun Uhr war sie im Büro, ein 13-Stunden-Tag. Da ist es wieder, das Japan, wie man es kennt, an der Oberfläche ein Albtraum. Aber Kishimoto wirkt nicht müde, sie klagt auch nicht über ihren Arbeitstag. Haben Sie heute viel gearbeitet, Frau Kishimoto?
Haben Sie heute viel gearbeitet, Frau Kishimoto?
»Nein, es gab eher wenig zu tun, weil ich gerade krank war. Aber mein Chef war lange im Büro heute. Ich gehe nicht vor meinem Chef nach Hause«, sagt sie.
Verlangt Ihr Chef das von Ihnen?
»Nein – ich bin motiviert, ich will arbeiten. Europäer denken da vielleicht anders«, sagt sie und erklärt etwas umständlich, dass sie ihre Krankheitstage für einen Makel halte, den sie ausgleiche. Nicht weil ihr Chef das verlange. Sondern weil es ihrem Selbstbild als einer guten Mitarbeiterin entspreche. Laut einer repräsentativen Umfrage aus der Zeitschrift Japan Labor Review sagen japanische Arbeiter, die viele Überstunden machen, »sie wollen damit etwas erreichen, mit dem sie selbst zufrieden sein können«. Urlaub hat sich Kishimoto das letzte Mal im vergangenen Sommer gegönnt, Paris, Berlin, London, eine Woche Europa im Schnelldurchlauf.
Ein 50-jähriger Durchschnittsjapaner hat laut dem Japan Institute of Labour im Jahr 33,1 Tage bezahlten Urlaub, nimmt davon aber nur 8 Tage in Anspruch. Die Freizeitverweigerung japanischer Arbeitnehmer geht so weit, dass Konzerne wie der Narita-Flughafen, an dem Miyamoto arbeitet, ihren Mitarbeitern zwei Urlaubstage schenkten, wenn sie sich doch bitte einmal länger als drei Tage am Stück freinähmen. Der Kosmetikhersteller Shiseido schaltet um 22 Uhr in allen Büros die Lichter aus, um die Mitarbeiter zum Feierabend zu zwingen. Bei Nippon Oil darf sich kein Mitarbeiter ohne Genehmigung nach 19 Uhr auf dem Firmengelände aufhalten, Workaholismus streng verboten. Während in Deutschland die Sorge um zu wenig Freizeit meistens aufseiten der Arbeitnehmer besteht, sorgen sich in Japan umgekehrt die Chefs um die Arbeitswut ihrer Untergebenen.
Japaner haben im Schnitt sogar fünf Tage mehr Urlaub im Jahr als Deutsche. Theoretisch. Dazu kommen 14 gesetzliche Feiertage, von denen es in Deutschland, je nach Bundesland, nur 9 bis 13 gibt. Wenn sie Lust hätten, könnten Japaner den Deutschen die Strände auf Mallorca streitig machen – aber sie wollen nicht. Man kann das überfleißig nennen oder dumm – oder verstehen, was Kishimoto sagt: »Es bringt mir nichts, Urlaub zu haben, wenn ich mich dabei schlecht fühle.«
Wer Japan nicht versteht, sollte den deutschen Botschafter in Tokyo, Volker Stanzel, besuchen. Stanzel, studierter Japanologe, ist Japan-Erklärer von Beruf. Gerade haben ihn drei Abgeordnete des Bundestages besucht. Alle fragen immer dasselbe: Warum sind die Japaner so? Stanzel zieht in seinem Büro die Jalousien zu. »Japan muss man sich als Kollektiv denken. In japanischen Unternehmen entscheidet nicht der oberste Chef, sondern die Gemeinschaft.«
Deshalb sei die Anwesenheit der Mitarbeiter auch so wichtig. »Man ist im Büro, weil alle da sind, aber nicht, weil so viel zu tun ist.« Deshalb werde auch nicht von zu Hause gearbeitet – man könne das Großraumbüro ja nicht mitnehmen. Dann sagt Stanzels Mitarbeiter, der Arbeitsmarktexperte Martin Pohl, etwas Interessantes: »Japanische Firmen haben eine andere Prioritätensetzung. Zuerst kommt der Kunde, dann der Mitarbeiter, dann der Gewinn. Das ähnelt mehr dem rheinischen Kapitalismus als unserem Shareholder-Value-Denken in Deutschland heute.«
Rheinischer Kapitalismus am Sumida-Fluss? Treffen Deutsche in Japan auf das, was die Bonner Republik einst war, niedrige Managergehälter, eine solide Mittelschicht, Wohlstand für alle? Womöglich. Selbst das neue Prekariat, das viele in Japan entstehen sehen, erweist sich bei genauem Hinsehen als eine Klage auf hohem Niveau. Zwar ist in Japan mittlerweile ein Drittel der Erwerbstätigen als Zeitarbeiter ohne Kündigungsschutz angestellt. Tatsächlich bedeutet das aber nicht, dass die Arbeitgeber von diesem Kündigungsrecht auch in großem Umfang Gebrauch machen. Japaner arbeiten im Schnitt immer noch 12,1 Jahre für ein Unternehmen, mit steigender Tendenz, so lange wie in keinem anderen Industriestaat der Erde.
Was also bleibt vom Klischee des Ameisenvolkes, auf dessen Schreibtischen die Lampen jedes Jahr tatsächlich ein paar Stunden länger brennen als in Deutschland, auch wenn das nicht mehr Arbeit bedeutet?
Scheinbar leben viele Japaner im Korsett einer freiwilligen Selbstkontrolle, einer Sehnsucht nach dem Glück des Fleißigen, während viele Deutsche sich im Strandsessel bei einer Piña colada am ehesten in ihrer Würde als Mensch bestätigt fühlen.
Manchmal verschwimmen die Unterschiede zwischen beiden Ländern aber auch in ihr Gegenteil. Manager Miyamoto hat mehr Ehrfurcht vor der Arbeitsmoral in Deutschland als vor seiner eigenen. »Sie kennen wirklich Anwälte großer deutscher Kanzleien, die am Sonntag ins Büro gehen?«, fragt er und staunt. »Sehr fleißig, ihr Deutschen, wirklich sehr fleißig!«
Aus:Zeit.de

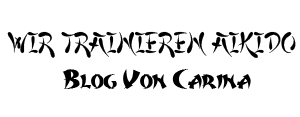





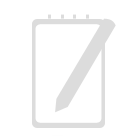

Neueste Kommentare