Der Shogun Ieyasu hatte eine Heidenangst vor Attentätern; vermutlich zu Recht, denn seine Feinde waren zahl- und listenreich und die Klingen in Japan bereits vor vierhundert Jahren sashimimesserscharf geschliffen. Die Korridore seiner Residenz in Kyoto ließ der Shogun deshalb mit einem „Nachtigallenfußboden“ auslegen; Holzdielen, die mit eisernen Krampen so befestigt waren, dass jeder Schritt ein zartes Piepsen hervorrief; nicht gerade das Tirilieren einer Nachtigall, eher das Gewisper eines Starenschwarms. Doch in der Nacht, wenn alle den Schnabel hielten, waren die Gemächer des Ninumaro-Palasts von einem perfekten Warnsystem umgeben. Heute ist der „Nachtigallenfußboden“ der vielen Besucher wegen mit einem strapazierfähigen Läufer bedeckt, und nur wer auf besockten Füßen danebentritt und – das Ohr in Kniehöhe – auf den Dielen weiterschleicht, vernimmt das Zwitschern.
Die Residenz der militärischen Machthaber in Kyoto gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Vor den Audienzsälen sind Audiosysteme installiert, deren Plärren die Leibwächter vermutlich sofort aus den Wandschränken gejagt hätte. Leer bis auf fußschmeichelnde Tatamimatten sind diese dämmrigen Räume, ausgemalt mit Pfauen und Pfingstrosen, blühenden Ki rschbäumen und knorrigen Kiefern vor goldenem Hintergrund. Wachsfiguren stellen die Hofgesellschaft dar: den Shogun, in Brokatgewändern ausladend zwischen seinen Damen nistend. Damals empfand man es als hübsch, wenn die Augenbrauen abrasiert und die Zähne schwarz angemalt waren. Aber die Seidenkimonos strahlen eine unvergängliche Eleganz aus.
rschbäumen und knorrigen Kiefern vor goldenem Hintergrund. Wachsfiguren stellen die Hofgesellschaft dar: den Shogun, in Brokatgewändern ausladend zwischen seinen Damen nistend. Damals empfand man es als hübsch, wenn die Augenbrauen abrasiert und die Zähne schwarz angemalt waren. Aber die Seidenkimonos strahlen eine unvergängliche Eleganz aus.
Akropolis auf Japanisch
Das Leise und das Laute, das Befremdliche und das Hinreißende, die schöne Form und die schauerliche Entgleisung sind in Kyoto eng benachbart. Die eintausendzweihundert Jahre alte Kaiserstadt, die sich ihrer Tempel, Schreine und Gärten rühmt, ist Neuschwanstein plus Akropolis auf Japanisch, mit großen Busparkplätzen und großen Trupps, die hinter einer gouvernantenhaften Erscheinung mit Hut und aufgepflanztem Fähnchen hermarschieren: zum Kinkaku-ji-Pavillon, dessen blattgoldene Stockwerke sich im Wasser eines Sees spiegeln; zu den tausend Buddha-Statuen des Sanjusangen-do-Tempels; hügelan über die von Souvenirläden gesäumte Auffahrt des Kiyomizu-dera-Tempels und durch den Ryoan-ji-Garten zum Seerosenteich und dem ummauerten Zen-Garten. Seine kosmische Leere, der gerechte Kies um die fünfzehn Steine, von denen einer dem Betrachter immer verborgen bleibt, soll die meditative Versenkung befördern, aber überall sind Stimmen und Füße, gelbe Schülermützen, blaue Faltenröcke, Mundschutz und auf jedem Foto zwei gereckte Victory-Finger.
Kyoto ist heute auch Millionenstadt mit den weltüblichen Klopsbuden, Verkehrsproblemen und einem gorgonenhaften Geschlinge schwarzer Stromleitungen über den Straßen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurden vierzigtausend traditionelle Holzhäuser mit ihren Bambusrollos und papierbespannten Schiebetüren abgerissen. An ihre Stelle ist das Verwechselbare getreten, brutalstmögliche Betonfassaden, auch gern vor dem Pagodendach eines fünfhundert Jahre alten Tempels.
Schlepprock und lackschwarzes Haar
Eines der Stadtviertel, in dem die Tradition in leicht musealer Form fortbesteht, ist Gion, das ehemalige Vergnügungsviertel mit seinen Teehäusern und Restaurants. Tagsüber ist es still in den Gassen. Die Arbeiterinnen der Nacht, Geishas, die in Kyoto Geikos heißen, und Maikos, ihre lieblichen Lehrlinge, halten Schönheitsschlaf. Erst abends, wenn die roten Papierlaternen aufleuchten, sieht man sie aus den Türen der Okiyas treten, der Frauenwohngemeinschaften, in denen die Maikos unter Anleitung einer älteren Geiko ihre Lehrjahre verbringen, und in die kein Mann eindringt, es sei denn, er ist Friseur oder Perückenmacher.
Eine geschäftsmäßig im Kimono hergerichtete Maiko auf dem Weg zu einem Bankett, weiß und rot geschminkt und mit Flitter im lackschwarzen Haar, ist eine Erscheinung, nach der sich in Kyoto auch Japaner umdrehen. Wegen der hohen, vorn wie Kähne abgeschrägten Plateausandalen, des engen Schlepprocks und des festen Obis in der Mitte, der alles platt drückt, was an einer Frau rund ist, gleichen Maikos auch rollenden Puppen, deren Untergestell sie nicht weiter als bis zum wartenden Taxi an der Ecke trägt.
Lächeln mit geschlossenem Mund
Was lernt ein Mädchen in der Okiya, wenn es als Teenager diesem weltlichen Orden beitritt? Die Geiko Kosem, fünfundzwanzig, und Hashichika, die sechzehnjährige Maiko, sind in einem Teehaus am Fluss Kamo auf die Fragen von zehn westlichen Journalisten vorbereitet. Die Gäste haben ihre Schuhe im Eingang ausgezogen und auf Knien und Fersen Platz genommen. Kleine Biergläser stehen auf dem niedrigen Tisch, die von den beiden sich geschmeidig auf- und niederfaltenden Damen aus Flaschen nachgefüllt werden. Sie sind Gastgeberinnen, die selbst nichts trinken, und die Kleine lächelt mit geschlossenem Mund, von dem nur die Unterlippe krapprot geschminkt ist. Durch eine Übersetzerin dürfen auch „unhöfliche Fragen“ gestellt werden, aber selbst wenn man sich einigen könnte, was akzeptabel und was unmanierlich ist, bliebe diese hoch ritualisierte weibliche Lebensform den Fremden ein Rätsel.
Was also lernt eine Maiko? Einen vierhundert Jahre alten Stoff. Gehorsam und Respekt vor ihren Lehrern, die sie in traditionellem Tanz, Musik, Kalligraphie, Blumenstecken und der Teezeremonie unterweisen. Sie lernt, Herren zu unterhalten, ohne sie zu berühren oder berührt zu werden. Und in der Freizeit? Sie gehe ins Kino und zum Shoppen, lässt Kosem ausrichten. In Zivil. Als Geiko trägt sie eine Perücke. Eine Maiko kann ihr Haar nicht einfach ablegen. Es wird einmal in der Woche frisiert und fixiert. Vier Jahre lang schläft sie nachts auf einem kleinen Stützkissen.
Schnick, Schnack, Schnuck – und dann einen Sake
Genug gefragt? Jetzt wird getanzt. Zu wehen Klängen aus einem Recorder stellen Kosem und Hashichika gemessen und in tiefem Ernst die „vier Jahreszeiten in Gijon“ dar. Die ausgebreiteten Arme bedeuten den Sommer, die nach oben gekehrten Handteller den rieselnden Schnee, die nacheinander eingebogenen Finger die Tage, die sie auf den Geliebten warten. Habe man das nicht erkannt? Dann wechseln sie jäh zu guter Laune und spielen mit den Herren ein Kinderspiel, das an Schnick, Schnack, Schnuck erinnert. Die Geiko pflückt auf dem dreisaitigen Shamisen das Tempo, die Maiko gewinnt. Der Verlierer muss einen Sake kippen. Rätselhaftes Japan!
Alles ist seitenverkehrt. Die Leute stehen auf der Rolltreppe links, schließen ihre Türen rechtsherum auf, fangen ihre Bücher von hinten an zu lesen, und von den sichtbaren Teilen einer Frau gilt der Nacken als die erotischste Stelle. Geikos schminken ihr Genick und lassen den Kragen des Kimonos hinten weit abstehen.
Kano Ko im Businesskimono
Ob eine Anprobe der äußeren Hülle etwas von der inneren Verfassung der Trägerin verriete? Die Firma Kano Ko, seit hundert Jahren am Platze, webt Gold-, Seiden- und Silberfäden zu kostbaren Obis, den viereinhalb Meter langen Kimonogürteln. An Chic und wundervoller Farbigkeit ist das komplette Gewand den meisten westlichen Kleidungsstücken überlegen. Hinein kommt man jedoch nur mit Hilfe von zwei Ankleiderinnen; hier zwei Damen von Kano Ko im Businesskimono, hechtgrau und anthrazit, und ihrem Sortiment an Bändern, Polstern und Klammern.
In den Verkaufsräumen, umgeben vom Perlenschimmer edler Stoffe, lassen sie die Probandin in die Fledermausärmel eines Unterkimonos schlüpfen, der kreuz und quer über der Brust verschnürt wird. Darüber kommt der eigentliche schilfgrüne seidene Kimono, in dessen Länge und Weite man leicht eine zweite Frau mit einwickeln könnte, und der, um die Mitte geschlungen, gerafft, gesteckt und mit einem orthopädischen Schild verstärkt wird. Dann faltet die Dame im Rücken den Obi zu einer Art Fallschirm. Darüber zieht die Dame vorn noch eine Zierkordel – fertig. Unbeugsam.
Gruppenfoto mit vierhundert Mönchen
Auf weißen Zehensocken trippeln wir zur Teezeremonie nebenan, die sich auf dem tatamibelegten Fußboden vollzieht. Hinunter kommt man immer irgendwie, sich zu verneigen und ohne zu kippen die kandierte Esskastanie mit einem Spießchen vom Papier aufzunehmen ist schon schwieriger. Die Sorge, ein geliehenes, achttausend Euro teures Gewand zu bekleckern, stört ein wenig den Seelenfrieden, den das Zen-Ritual verspricht. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Lächeln der beiden Damen, die den grünen Tee mit einem Bambuspinsel aufschlagen und die Schalen kniend reichen, auch ihre Belustigung über die ungeschlachten Rösser aus dem Westen und ihre beklagenswerten Tischmanieren. Bei Japanern weiß man nie.
Zen oder die Kunst, zwanzig Minuten stillzusitzen, ist dabei gar nicht so schwierig. In den weiten Räumen des Taizo-in im Tempelkomplex Myoshin-ji im Nordwesten Kyotos führt Taiko Matsuyama, ein milder junger Mönch mit randloser Brille und runden Kinderwangen, die Fremden in die Lehre ein. Sein buddhistischer Orden wurde vor sechshundertfünfzig Jahren gegründet. Zur Feier des Jubiläums stellen sich an diesem Tag vierhundert Mönche in dunklen Roben unter einem Pagodendach zum Gruppenfoto auf. Nur das Wischen ihrer Strohsandalen auf dem Holzboden ist zu hören und das tiefe Dröhnen der gewaltigen Glocke, die ein Mönch mit einem aufgehängten Rammbaum anschlägt.
Sandburgen im Trockensteingarten
Taiko Matsuyama wurde in Myoshin-ji geboren, schon seine Großmutter war Nonne. Er hat in Tokio Landwirtschaft studiert, kehrte jedoch zurück, und wenn er heiratet, wird er in der Tempelstadt wohnen, und seine Kinder werden in dem kostbaren Garten spielen, wo die Kiefern nicht geschnitten, sondern in Form gezupft werden, und vermutlich werden sie weder in den Teich mit dem Katzenwels fallen noch im Trockensteingarten Sandburgen bauen.
Morgens um sieben lässt Matsuyama seine Gäste im Meditationsraum vor den zurückgeschobenen Türen, die den immergrünen Garten rahmen, im Schneidersitz Platz nehmen. Zwanzig Minuten sollen sie nur aufrecht sitzen, schweigen und atmen. Wer ermattet, darf mit zusammengelegten Händen um den „Stock der Barmherzigkeit“ bitten, eine lange Latte, die Matsuyama dem Zusammensackenden zur Erfrischung auf die Schultern klatscht. Um das Gedankengestöber zu bannen, empfiehlt er, beim Ausatmen langsam zu zählen; atmen und zählen, schauen, hören, atmen und zählen, den Geist fließen lassen wie im Wellenmuster japanischer Dachziegeln. Regen flüstert in den Bäumen, die Erde duftet, Vögel pfeifen. Dann schlägt der Mönch zwei Stäbe zusammen. Es ist vorbei.
Was weiß man schon?
Nun gibt es Frühstück, für jeden ein rotes Lacktablett voller Häppchen in Schälchen. Die Zen-Küche ist vegetarisch und reizarm: Blättchen, Hälmchen, Brühe, Tofu, Reis. Zehn Paar Essstäbchen kreisen unschlüssig: Was wird hier wo eingetunkt und wenn, in welcher Reihenfolge? Darf man Brötchen mit dem Löffel essen und Kaffee übers Rührei kippen? In Japan weiß man’s nie.
Aus: Faz.net
Kandierte Kastanien im Kimono knabbern
Hinterlass eine Antwort
Du musst sein Eingelogged um einen Kommentar zu hinterlassen.

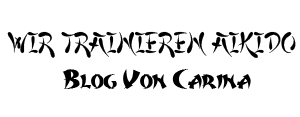





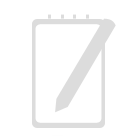

Neueste Kommentare