Sie haben ihren Job verloren und ihre Wohnung. Nun richten sie sich auf der Straße ein: in Null-Yen-Häusern. Ein Phänomen.
„Null-Yen-Häuser“ – so nennt der Architekt und Künstler Kyohei Sakaguchi die meist quaderförmigen Hütten. Weil sie aus Materialien bestehen, die so gut wie nichts kosten. Seit den 90er Jahren gehören die „Null-Yen-Häuser“ zum Bild japanischer Großstädte. Damals konfrontierte das abrupte Ende des Wirtschaftsbooms das Land mit einem bis dahin fast unbekannten Problem: Obdachlosigkeit. Derzeit leben etwa 30 000 Japaner auf der Straße. Verglichen mit den hunderttausenden Wohnungslosen in Deutschland, ist die Zahl noch immer niedrig. Außergewöhnlich ist aber vor allem, dass viele Obdachlose streng genommen gar nicht obdachlos sind. Sie haben sich, wie die Menschen am Sumida, ein neues, improvisiertes und oft seltsam heimeliges Zuhause aufgebaut. Ihre „Null-Yen-Häuser“ sind funktional und verblüffend gut konstruiert. Der Architekt Sakaguchi ist von diesem Einfallsreichtum fasziniert, davon, wie sich Menschen aus dem Nichts eine oft sehr individuelle Bleibe schaffen. „Ich will das harte Leben in Parks oder unter Schnellstraßen nicht idealisieren, aber viele Häuser sind fast ein Stück Kunst und haben es verdient, beachtet zu werden“, sagt der 31-Jährige.
Sakaguchi hat Obdachlosensiedlungen in mehreren Städten fotografiert, den Alltag der Bewohner dokumentiert und Zeichnungen vom Aufbau der Häuser angefertigt, die ihn in ihrer Einfachheit an alte japanische Bautraditionen erinnern. Einige Skizzen und Bilder veröffentlichte er auf seiner Internetseite (http://www.0yenhouse.com/) und zeigte sie 2007 sogar auf dem Weltsozialforum in Nairobi. Eine englischsprachige Ausgabe seines Buchs „Zero Yen Houses“ ist beim Verlag Little More erschienen (www.littlemore.co.jp/en/, rund 45 Euro).
Auf einem von Sakaguchis Fotos ist ein Haus mit angeschlossener Hundehütte zu sehen, auf einem anderen ein Häuschen im Park, vor dem unzählige Blumenkästen stehen, die wie ein Vorgarten wirken. Ein Obdachloser in Osaka hat seine Unterkunft aus Holz und Wellblech um einen rotgestrichenen Schrein erweitert, ein anderer gleich eine zweigeschossige Herberge errichtet, inklusive einer Karaoke-Anlage im Erdgeschoss. Sakaguchis spektakulärste Entdeckung aber ist das „Solar Zero Yen House“ eines 60-jährigen Mannes in Tokio, zusammengeklaubt aus Abfällen und Sonderangeboten. Im Innern ist es mit Holz ausgekleidet, dort befinden sich eine Tatami-Matte, Bettzeug, ein kleines Regal mit einem alten Radio, eine Halterung für Handtücher oder Klopapier und sogar ein Fernseher. Der Spion in der Tür, die man nach oben aufklappen kann, ist aus zwei Kamerafiltern konstruiert – der Mann hatte zuvor für eine Kamerafirma gearbeitet. Draußen über dem Eingang hängt eine Solarplatte, so groß wie zwei Handflächen. Sie bietet Strom für die elektrischen Geräte. „Das Haus besteht aus Dach, Mittelteil und Boden, und diese drei Teile können schnell auseinander genommen und anderswo wieder aufgebaut werden“, sagt Sakaguchi. Denn obwohl die Obdachlosen meist geduldet werden, müssen sie sich manchmal auf Druck der Polizei doch einen neuen Platz für ihre Häuschen suchen.Obdachlose haben es in Japan noch schwerer als anderswo. Ihr Ansehen ist niedrig, nach wie vor mangelt es an staatlichen Notunterkünften. Viele schämen sich zutiefst. Die „Null-Yen-Häuser“ sind der Versuch, niemandem zur Last zu fallen und trotzdem ein halbwegs geordnetes und respektables Leben aufrechtzuerhalten. Deshalb ist es in den Siedlungen so sauber, deshalb wird nicht gebettelt. Einige der Menschen dort arbeiten sogar, können sich die hohen Wohnungsmieten in den großen Städten aber nicht leisten.
„Manche campieren einfach in Zelten“, sagt Ernesto Braam, ein niederländischer Diplomat und Fotograf, der während seiner Zeit in Japan Obdachlose im Tokioter Yoyogi-Park porträtierte – die Bäume dort schützen nicht nur vor Regen und Sonne, sondern auch vor neugierigen Blicken. „Die Atmosphäre in den Siedlungen ist ruhig. Etwa fünf Häuschen oder Zelte bilden jeweils eine Nachbarschaft, man kennt und hilft sich.“
Braams Bilder sind heute Teil der Sammlung der britischen Tate Gallery. Der Niederländer ist den Tokioter Obdachlosen so nahe gekommen wie wenige Ausländer. Über Monate besuchte er eine Gruppe von sechs Leuten, darunter eine Frau und ihren Lebensgefährten. Im Sommer saßen sie zusammen an einem Tisch zwischen den Häusern, tranken Bier und aßen frittierten Fisch, der auf einem Gaskocher zubereitet wurde.
Einer von denen, die der Niederländer traf, ist Shigemi Naito. Der 47-Jährige posierte für ihn im Anzug und mit Handy. „Ein stolzer Typ“, sagt Braam. „Er achtet sehr auf seine Hygiene, wäscht sich jeden Tag in einem öffentlichen Bad.“ Naito lebte schon ein, zwei Jahre im Park, als Braam ihn fotografierte – und auch einen Blick in sein Haus werfen konnte. „Da hingen Anzüge und frisch gewaschene weiße Hemden auf einer Stange, die anderen Kleider hatte er in einer Ecke gestapelt“, erzählt der Niederländer. „Er besaß auch einige Armbanduhren und bewahrte Briefe und persönliche Wertsachen in kleinen Pappboxen auf.“ Naito hatte vorher bei seinem Bruder gewohnt, flog aber irgendwann raus und hält sich seitdem mit Gelegenheitsarbeiten als Maler oder im Straßenbau über Wasser. Manchmal ist er für einen Job wochenlang unterwegs. Wenn er dann in den Yoyogi-Park zurückkehrt, kommt er trotz aller Widrigkeiten: nach Hause.Was braucht es, um sich ein Heim zu schaffen? Gar nicht so viel, glaubt Kyohei Sakaguchi. Im Notfall genügen Kreativität, wie sie jedem von Natur aus mitgegeben ist, und ein paar Dinge, die andere wegwerfen. „Die Häuser zeigen auch, in was für einer Überflussgesellschaft wir leben“, sagt der Architekt, der mit seinem Buch das schlechte Bild, das viele Japaner von den Obdachlosen haben, geraderücken will. Einmal hat er ein Pärchen getroffen, das sich bewusst für das Wohnen im „Null-Yen-Haus“ entschied; die beiden führen als Aussteiger ein extrem bescheidenes Leben. An ihrem recht großen Haus hängen Pfannen und Besen, drinnen stehen gleich mehrere Stereoanlagen. Sie hätten alles auf den Straßen von Tokio besorgt, erzählte der Mann Sakaguchi, „nicht einen einzigen Nagel haben wir kaufen müssen“.

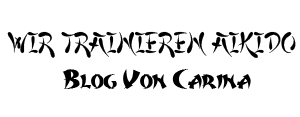





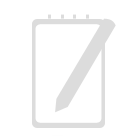

Neueste Kommentare